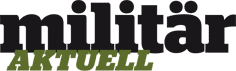Er ist der populärste Politiker Deutschlands, obwohl er kaum lächelt, selten pathetisch wird und sich nicht um Applaus bemüht. Verteidigungsminister Boris Pistorius führt die Bundeswehr durch eine Zeitenwende, während die Gesellschaft kriegsmüde wird und die Welt unübersichtlicher. Sein Erfolg beruht nicht auf Begeisterung, sondern auf etwas, das rar geworden ist: Vertrauen. Ein Porträt.
Warum trägt der römische Zenturio im neuen Asterix-Heft den Namen Pistorius? Wegen der sicheren Niederlage gegen die Gallier? Oder weil der Name inzwischen vertraut klingt? Fest steht: Boris Pistorius funktioniert mittlerweile auch in der Popkultur. Für einen deutschen Verteidigungsminister ist das bemerkenswert. Er ist nicht mehr nur Fachpolitiker, sondern eine Figur des öffentlichen Lebens, erkennbar, fest verankert. Einer, dessen Name reicht.
Boris Pistorius wird 1960 in Osnabrück, Niedersachsen, geboren und wächst dort auf. Er ist der Stadt bis heute eng verbunden. Seit dreißig Jahren besitzt er eine Dauerkarte für den VfL Osnabrück, jenen Klub, der häufiger absteigt als aufsteigt. Sein Bruder Harald schreibt jahrzehntelang über diesen Verein, erst als Sportredakteur, später als Ressortleiter der Neuen Osnabrücker Zeitung. Fußball, Verein, Verlässlichkeit. Das sind keine Nebensächlichkeiten, sondern Grundmuster.
In seiner Jugend spielt Pistorius Fußball im Verein Schinkel 04, dessen Jugendabteilung der Vater aufbaut und leitet. Die Mutter tritt wegen Willy Brandts Ostpolitik in die SPD ein. Politik gehört früh zum Alltag. Als Pistorius in Westdeutschland Russisch als Abiturfach wählt, ist das ungewöhnlich. Es ist kein strategisches Signal, sondern Neugier. Ein frühes Interesse am Gegenüber, das sich bis heute durchzieht.
„Er fällt nicht durch große Reden auf, sondern durch Präsenz. Einer, der Akten liest. Einer, der Sitzungen aushält.”
Pistorius’ Karriere ist nicht die eines steilen Aufstiegs. Er wird 2006 Oberbürgermeister von Osnabrück und bleibt es sieben Jahre lang. 2013 wechselt er in die Landespolitik und wird Innenminister von Niedersachsen, später auch zuständig für den Sport. Zehn Jahre lang trägt er Verantwortung für Polizei, Verfassungsschutz, Katastrophenschutz und innere Sicherheit. Harte, wenig glamouröse Felder. Er fällt nicht durch große Reden auf, sondern durch Präsenz. Einer, der Akten liest. Einer, der Sitzungen aushält.
Als Olaf Scholz ihn Anfang 2023 zum Verteidigungsminister macht, wirkt das zunächst überraschend. Pistorius ist bundesweit kaum bekannt. Scholz nennt ihn einen extrem erfahrenen Politiker, genau den Richtigen für eine Phase, in der der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die deutsche Sicherheitspolitik grundlegend verändert hat. Kein Designerkandidat. Keine politische Fantasiefigur. Sondern eine Lösung.
Dass Pistorius ausgerechnet in der Zeitenwende ins Amt kommt, macht vieles einfacher und zugleich schwerer. Die Erwartungen sind niedrig, die Lage ist ernst. Die Bundeswehr ist marode, der Reformbedarf offenkundig. Pistorius benennt Defizite offen, beinahe nüchtern. Keine Beschönigung, aber auch kein Alarmismus.
Er spricht, wie jemand spricht, der nicht verführen will, sondern erklären. In Pressekonferenzen redet Pistorius langsam, fast trocken, selten mit Notizen, oft mit der Haltung eines Mannes, der lieber erklärt als überzeugt. Das kommt an. Pistorius wird schnell zum beliebtesten Politiker Deutschlands. Nicht, weil alle seine Positionen teilen, sondern weil viele ihm zutrauen, zu wissen, was er tut.
Wer Boris Pistorius heute beobachtet, erlebt einen Verteidigungsminister, der fast demonstrativ auf Überhöhung verzichtet. Er spricht über Krieg, Abschreckung und Aufrüstung in einem Ton, der eher an Verwaltungsroutinen erinnert als an geopolitische Dramen. Keine großen historischen Vergleiche, keine moralischen Erregungswellen. Das wirkt unspektakulär. Und gerade deshalb glaubwürdig.

In der Ukrainepolitik folgt Pistorius einer klaren Linie. Waffenlieferungen seien notwendig, solange Russland den Krieg fortsetze. Öffentliche Kritik an Kiew vermeidet er konsequent. Nicht, weil er keine Probleme sieht, sondern weil er Geschlossenheit für einen militärischen Wert hält. Wer sich öffentlich distanziert, schwächt aus seiner Sicht die Front. Diese Haltung ist außenpolitisch konsistent, innenpolitisch jedoch zunehmend erklärungsbedürftig. Die deutsche Gesellschaft hat sich verändert. Die anfängliche Eindeutigkeit der Solidarität ist einer vorsichtigeren Haltung gewichen. Unterstützung ja, aber mit Grenzen. Mehr Diplomatie, weniger Eskalation. Pistorius nimmt diese Stimmung wahr, richtet seine Politik aber nicht nach ihr aus.
Boris Pistorius steht für Sicherheitspolitik in einer Gesellschaft, die Sicherheit will, aber Krieg fürchtet. Er spricht zu einem Land, das Abschreckung akzeptiert, Eskalation jedoch misstraut, das Bündnisse braucht, aber militärische Härte nur widerwillig mitträgt. Seine Popularität erklärt sich aus genau diesem Zwischenraum. Er verspricht keinen Sieg und keine Erlösung, sondern Kontrolle, Begrenzung und Ordnung in einer Welt, die vielen entgleitet.
Ähnlich agiert er im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten. Während das Vertrauen vieler Europäer in die USA brüchiger geworden ist, hält Pistorius demonstrativ am transatlantischen Rahmen fest. Offene Kritik vermeidet er. Auch das ist kein Wegducken, sondern Kalkül. Die Nato funktioniert nur, wenn Differenzen nicht öffentlich eskalieren.
„Er verspricht keinen Sieg und keine Erlösung, sondern Begrenzung und Ordnung in einer Welt, die vielen Entgleitet.”
Pistorius spricht selten von europäischer Autonomie, ohne zugleich die NATO zu nennen. Europa ist für ihn kein Gegenentwurf, sondern ein Pfeiler im bestehenden Bündnis. Diese Logik prägt auch seine Haltung zur Arktis. Mit Blick auf Grönland fordert Pistorius eine stärkere NATO Präsenz, durch Überwachung, Patrouillen und Sichtbarkeit. Gleichzeitig betont er, dass alle Schritte eng mit Dänemark abgestimmt und nichts gegen den Willen der USA unternommen werden solle. Auch zum Iran spricht Pistorius in diesem Ton. Ein von außen erzwungener Regimewechsel, sagt er, sei selten der Beginn von Stabilität, sondern oft der Auftakt neuer Probleme. Es ist Sicherheitspolitik ohne missionarischen Anspruch, getragen von Erfahrung statt Überzeugungseifer.
Privat hat Pistorius früh gelernt, was Verantwortung bedeutet. Seine erste Ehefrau Sabine stirbt 2015 an Krebs. In der Traueranzeige schreibt er, sie gehe nicht weg, sie gehe weiter mit uns, auf der anderen Seite des Weges. Später sagt er über diese Zeit: „Ich musste funktionieren.” Ein Satz, der viel erklärt. Pistorius ist keiner, der Gefühle ausstellt. Aber er verdrängt sie auch nicht. Er trägt sie mit sich, leise. Wer erlebt hat, dass es Dinge gibt, die sich nicht kontrollieren lassen, dramatisiert politische Krisen vielleicht weniger.
Pistorius spricht offen darüber, dass er von starken Frauen geprägt wurde, von seiner Mutter, seiner verstorbenen Frau, seinen Töchtern, später auch von Doris Schröder Köpf, der früheren Ehefrau des ehemaligen deutschen Bundeskanzlers Gerhard Schröder. Nach der Trennung lobt sie ihn öffentlich. Heute ist er mit der Politikwissenschaftlerin Julia Schwanholz verheiratet. Beziehungen sind bei ihm kein politisches Kapital, sondern privater Halt.
Pistorius Führungsstil hat eine Kehrseite. In der Affäre um das Fallschirmjägerregiment 26 wirft ihm die FAZ vor, zu lange geschwiegen zu haben. Rechtsextremismus, Frauenhass, sexuelle Gewalt, all das wurde über Monate untersucht, während der Minister sich erst spät äußerte. Weggefährten sagen, dies sei kein Wegsehen aus Gleichgültigkeit, sondern ein Zögern aus Ordnungssinn. Pistorius glaube an Strukturen, an Disziplin, an innere Klärung. Er greife erst ein, wenn das System selbst gefährdet ist. Für Betroffene kann das zu spät sein. Auch beim neuen Wehrdienst zeigt sich dieser Pragmatismus. Zwanzigtausend Freiwillige im ersten Jahr, ein ehrgeiziges Ziel. Bessere Bezahlung, attraktivere Bedingungen, frühe Ansprache. Pistorius verspricht keinen Durchbruch, sondern eine Überprüfung. 2027 will er Bilanz ziehen.
Am Ende verliert der römische Zenturio im Asterix Band gegen die Gallier. Wie immer. Aber er verliert nicht lächerlich, sondern als Teil eines Systems, das größer ist als er selbst. Boris Pistorius ist kein Held und kein Visionär. Er ist der Mann, der Ordnung hält, wenn sie brüchig wird. Und vielleicht ist genau das in dieser Zeit seine größte politische Stärke.
Hier geht es zu weiteren Meldungen rund um die Bundeswehr.